Fallstudien in der Optimierung
Die Lehrveranstaltung "Fallstudien Diskrete Optimierung" findet seit 2009 statt und hat sich gemeinsam mit der Schwesterveranstaltung "Fallstudien Nichtlineare Optimierung" zum Erfolgsmodell entwickelt. Hier erleben Studierende jedes Sommersemester ganz real, was es heißt, komplexe mathematische Verfahren auf Probleme aus der Wirklichkeit anzuwenden, mit Praktiker:innen aus Forschung und Wirtschaft zusammenzuarbeiten und ihre Ideen und Ergebnisse öffentlich zu präsentieren.
Fallstudien: die Idee
"Anspruchsvolle Mathematik mit anwendungsorientiertem Profil" – so charakterisiert das Department of Mathematics der Technischen Universität München ihre Studiengänge. Diesen Anspruch leben wir in zahlreichen Projekten mit Partnern aus Industrie, Wirtschaft oder den Nachbardepartments aus den Ingenieurs-, Wirtschafts- und Lebenswissenschaften.
Damit unsere Studierenden bereits in der Ausbildung Mathematik anwenden, haben wir die Veranstaltungen "Fallstudien Diskrete Optimierung" und "Fallstudien Nichtlineare Optimierung" ins Leben gerufen. Hier setzen die Studierenden das um, was sie in Vorlesungen lernen – in realen Projekten mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten.
Dabei gilt es, zunächst eine praktische Herausforderung zu verstehen und dann in kleinen Teams zu modellieren und zu analysieren. Anschließend entwickeln und implementieren die Studierenden geeignete Lösungsansätze. Dabei kooperiert unser Department in der Regel mit externen Partnern.
Die Entstehung
Die erste Veranstaltung "Diskrete Optimierung: Fallstudien aus der Praxis" im Sommersemester 2009 war ein voller Erfolg – und erhielt den Felix Klein-Lehrpreis der damaligen Fakultät für Mathematik. Seitdem sind die regelmäßigen Veranstaltungen "Fallstudien Diskrete Optimierung" und die "Fallstudien Nichtlineare Optimierung" zentrale Bestandteile des Studiengangs Master Mathematics in Operations Research.
Ablauf einer Fallstudie
Die Studierenden starten in 3- bis 5-köpfigen Teams mit ihrer Projektarbeit. Sie lernen die Projektpartner kennen, planen gemeinsam die Projektziele und das konkrete Vorgehen, erstellen einen Zeitplan und verteilen Verantwortlichkeiten. Regelmäßige Absprachen mit den Betreuer:innen stellen sicher, dass die gegenseitigen Erwartungen an die Projektarbeit aufeinander abgestimmt und die gesteckten Ziele realistisch sind.
Schon während die Teilnehmer:innen die Problemstellung erarbeiten, fertigen sie eine Darstellung ihres Projekts in Form eines Posters an. Dieses präsentieren die Teams im Rahmen einer Veranstaltung für die Öffentlichkeit – etwa für Oberstufenschüler:innen, die uns im Kontext verschiedener Schulprogramme besuchen.
Selbstverständlich unterstützen die Betreuer:innen die Studierenden professionell. Die Gruppen berichten regelmäßig von ihren Fortschritten und planen das weitere Vorgehen. Dabei diskutieren sie fachliche Fragestellungen und erhalten technische Unterstützung. In Soft-Skill-Einheiten üben die Studierenden Foliengestaltung, Strukturierung und Präsentation.
In einem Zwischenvortrag in der Mitte des Semesters berichtet jedes Team über den aktuellen Stand seines Projekts und erhält ausführliche Rückmeldungen von den anderen Teilnehmer:innen und Betreuer:innen. Höhepunkt und Abschluss der Fallstudien bildet der eintägige wissenschaftliche Workshop SCoNDO, den die Betreuer:innen der beiden Fallstudien-Module gemeinsam veranstalten.
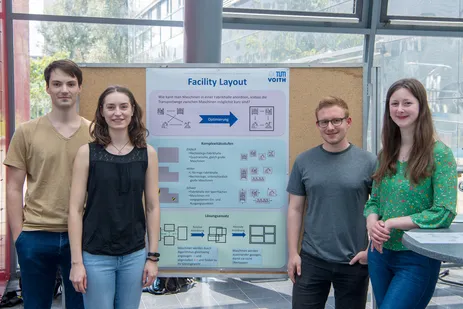

SCoNDO – der Abschluss-Workshop
Die Students' Conference on Nonlinear and Discrete Optimization (SCoNDO) findet einmal jährlich im Sommer statt. Hier präsentieren die Teilnehmer:innen der beiden Kurse "Fallstudien Diskrete Optimierung" und "Fallstudien Nichtlineare Optimierung" ihre Projekte und stellen ihre Ergebnisse in einem kurzen öffentlichen wissenschaftlichen Vortrag vor.
Zudem können sie die spezifischen Herausforderungen, die mathematische Theorie und die praktischen Ergebnisse in kurzen Frage-und-Antwort-Runden und während der Kaffee- und Mittagspausen diskutieren. Ein gemeinsames "Conference Dinner" schließt die Veranstaltung ab.
Die Konferenz ist für Besucher:innen offen. Alle, die sich für mathematische Optimierung und ihre Anwendungen in realen Projekten interessieren, laden wir herzlich ein. Machen Sie sich also selbst ein Bild und sprechen Sie mit unseren Studierenden. Die nächste ScoNDO findet am 14. und 15. Juli 2025 statt. Genauere Informationen werden an dann an dieser Stelle veröffentlicht.
SCoNDO 2025
Unser Case Studies-Workshop findet am 14. und 15. Juli 2025 auf dem TUM-Campus Garching-Hochbrück im Hörsaal BC2 0.01.17 (Parkring 35-39, 85748 Garching b. München) statt. Die Vorträge beginnen an beiden Tagen um 16:00 Uhr; TUM-Studierende, Mitarbeiter und alle, die an spannenden mathematischen Anwendungen in der Praxis interessiert sind, sind herzlich eingeladen. Wir bitten um eine kurze Anmeldung per E-Mail an michael.ritter(at)tum.de, damit wir für ausreichend Kaffee und Kekse sorgen können.
Programm
Montag, 14 Juli
16:00 – District Heating Networks
Team “District Heating Networks”
District Heating Networks offer a centralized, sustainable solution for delivering heat to residential areas. The focus of the case study was to develop and test models that can solve a profit maximization network problem and prove under which conditions an optimal solution can be found.
Two optimization models were designed: a Mixed-Integer Linear Program (MILP) and an iterative approach based on Prize-Collecting Steiner Trees (PCST). Using district data from Hamburg and with the help of Siemens, each model was applied to simulate realistic scenarios and assess their effectiveness under varying network conditions.
17:15 – Kaffeepause
17:45 – 2D to 3D: Reconstructing Reality
Team “3D Reconstruction”
Photometrically challenging surfaces, such as non-Lambertian materials, transparent objects, or scenes with repeating patterns, can significantly hinder the performance of traditional bundle adjustment (BA) methods. Our project aims to improve the robustness of COLMAP’s BA by replacing its default loss function with more robust alternatives and by incorporating lifting schemes. To improve the loss function, we employ the Barron loss with parameters analytically derived from local BA residuals and depth distributions, and apply it during the global BA phase. Lifting introduces point-wise weights as additional optimization variables, allowing the algorithm to downweight outliers and better reconstruct relevant scene points.
Since real image datasets often lack reliable ground truth, we evaluate our methods on synthetic data where ground truth is fully available. This includes both procedurally generated point clouds with synthetic cameras and Blender-based photorealistic renderings of 3D scenes. These controlled setups allow us to rigorously assess reconstruction quality using metrics such as reconstruction density and distance to the ground truth geometry.
Dienstag, 15 Juli
16:00 – Learning to Plan: Trajectory Optimization with Neural Signed Distance Fields
Team “Trajectory Optimization”
Autonomous robots must navigate dynamic, cluttered environments while respecting complex dynamics and collision constraints. Classical trajectory optimization methods often become computationally expensive in such settings, as they require a large number of geometric constraints for obstacle avoidance.
In this project, we investigate an alternative approach: approximating the environment using neural signed distance fields (SDFs), which provide smooth, differentiable representations of obstacles. These learned SDFs are integrated into an optimal control pipeline using multiple shooting and nonlinear programming techniques. We evaluate this method across a series of benchmarks and compare it to classical formulations, analyzing trade-offs in performance, robustness, and scalability. Our findings demonstrate that learning-based models can significantly reduce problem complexity while maintaining trajectory quality.
17:15 – Kaffeepause
17:45 – Inventory Routing
Team “Inventory Routing”
Industrial facilities rely on a steady supply of oil, gas, etc. stored in on-site tanks. To ensure smooth operations, these tanks are typically monitored by sensors, tracking consumption and helping to predict when refills are needed. While deliveries must occur before safety stock levels are violated, demand patterns are often predictable, allowing for flexibility in scheduling deliveries.
In this presentation we explore how to plan efficient delivery routes for multiple days, including selecting which facilities to service, incorporating the up-to-date data from the tank level monitoring sensors and available predictions ensuring the customers’ tanks never run empty.
We will first present a Mixed-Integer Programming model that accurately describes our problem. Based on this we will describe different algorithmic approaches, including a Mixed-Integer-Programming-Guided local search framework for vehicle routing as well as a heuristic algorithm consisting of three different parts: First, a customer selection, determining must-go and may-go customers and assigning delivery dates. Secondly, a sweep algorithm, constructing easy, but feasible, routes for the input of the last part. Finally, an adaptive large neighbourhood search, improving our first feasible solution. In the end we will present our computational results and compare our different approaches.
19:00 – Evaluation und Feedback
20:00 – Conference Dinner
Unsere Kooperationspartner
Partner in der Vergangenheit waren z.B. Audi, BMW, car2go, Deutsche Bahn, DLR, Flixbus, Framos, HAWE Hydraulik, iABG, IAV, Logivations, risklab GmbH, Siemens, das World Food Programme und immer wieder Forschungsinstitute aus anderen Departments der TUM.
Haben Sie auch ein Optimierungsprojekt, das sich für ein einsemestriges Studierendenprojekt eignet? Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer Kooperation. Wenden Sie sich dazu bitte an Dr. Florian Lindemann.
Praxis und Karriere für Mathematik-Studierende
Das Department of Mathematics bietet Ihnen weitere Möglichkeiten, bereits während des Studiums praktische Erfahrungen zu sammeln.
Das TUM Data Innovation Lab (TUM-DI-LAB) richtet sich an Master-Studierende, die an datengesteuerten Verfahren für interdisziplinäre praktische Aufgaben forschen wollen. Jedes Semester bietet das Lab neue Projekte.
Damit unsere Studierenden bereits im Bachelor-Studium lernen, anwendungsbezogen zu arbeiten, bieten wir ihnen die Fallstudien der mathematischen Modellbildung.